„Stramer“ von Mikołaj Łoziński: Was hätte sein können
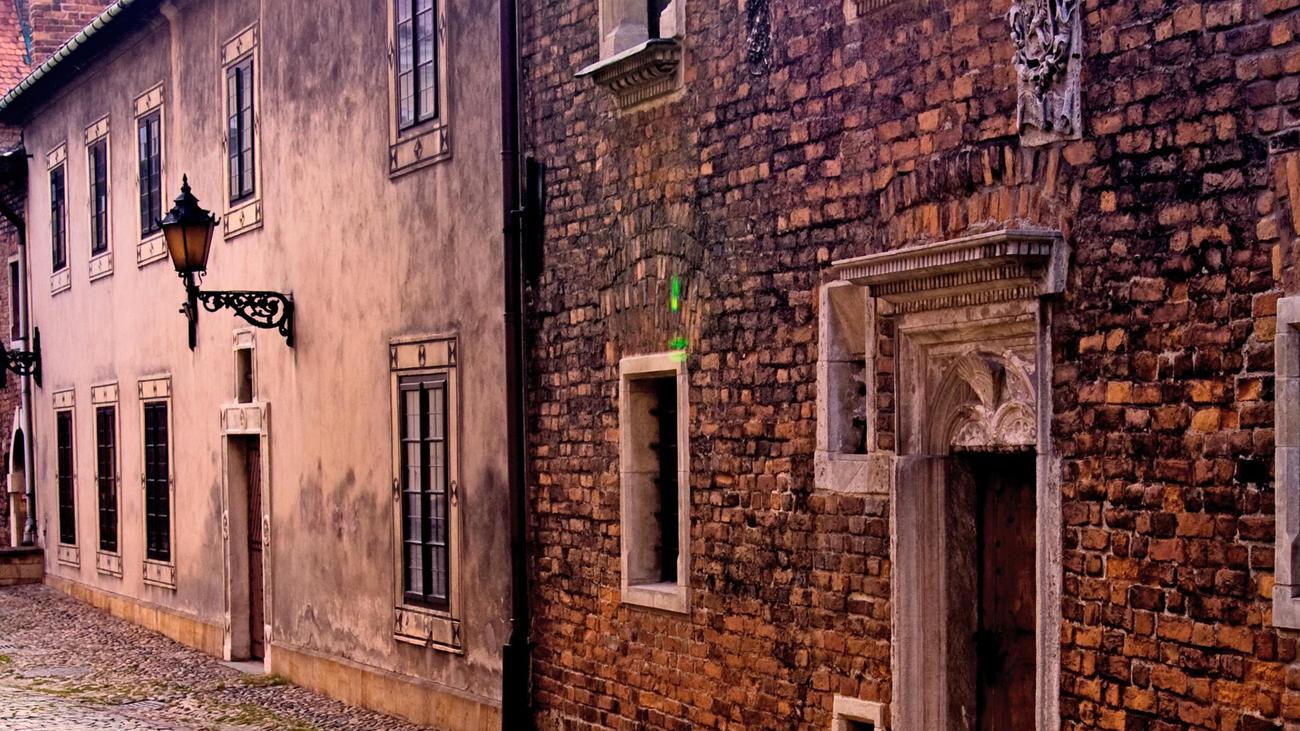
Sechs Kinder sind eine Aufgabe. Nathan und Rywka
Stramer sehen sie heranwachsen, der älteste Sohn Rudek hat
Kleinganoven-Geschäftssinn und Anführerinstinkt, beides geht dem verzettelten
Vater ab. Die zwei mittleren Söhne werden Kommunisten oder zumindest das, was
sie dafür halten. Hintendran hängt Nusek, fühlt sich ausgeschlossen, ringt
damit, sich von den Brüdern abzusetzen. Die Töchter Wela und Rena strampeln unterschiedlich
mit den Rollenerwartungen. Alles aktuelle Konflikte, sie spielen allerdings in
einer jüdischen Familie in Tarnów, Anfang der 1930er-Jahre – Parterrewohnung,
Tisch und Stühle wackelig, Armut, Enge, ringsum wachsender Judenhass.
Mikołaj Łoziński erzählt in seinem Roman Stramer vom geografischen und sozialen Rand der polnischen Gesellschaft, über dem sich der
düstere Horizont der Ereignisgeschichte auftut. Die Stramers sind den Dingen
ausgesetzt, mühen sich, versuchen Aufstiegsverheißungen zu folgen, müssen aber
jeder für sich erkennen, wie rasch Möglichkeiten schwinden, sich von der Unbill
fernzuhalten.
Der Roman ist breit angelegt, die Perspektiven
springen zwischen den handelnden Personen, jede einzelne erzählt Łoziński
aber auktorial. Nathan fremdelt sehr mit den Alltagsanforderungen, seine
Versuche in Tarnów über die Runden zu kommen, stehen im Kontrast zur Verklärung
seiner vergangenen Episode in New York. Er versucht es mit Geschäften, dann
einem Café, arbeitet eine Weile als Versicherungsvertreter. Über Wasser
gehalten wird alles von Dollars, die Onkel Ben aus New York schickt. Von dort stammt
auch Nathans Gürtel, mit dem er die Jungs vertrimmt.
Rywka kompensiert viel im klassischen
Geschlechterspiel des frühen 20. Jahrhunderts, lauscht genauer, wenn ihre
Kinder am Abend erzählen, spürt nichtgelebtem Leben nach, träumt sich ins Kino
oder ans Meer. In dem Maße, in dem die Kinder älter werden, übernehmen sie das
Ruder des Romans, lassen die Eltern nach und nach zurück. Und sie öffnen den
Blick, ziehen nach Kraków, leben in wilder Ehe, suchen nach Wahrheit. Das
durchmisst dann auch mal den Zwiespalt zwischen Marx‘ Schriften und Stalins
Interpretation.
Manches, was der Roman sein Personal durchleben
lässt, wirkt ausgestellt, als würden Thesen illustriert. Ab und an wird es
heiter. Nur wird die Lage zunehmend bedrückend: Nach dem Tod des autoritären
Staatslenkers Józef Piłsudski im Jahr 1935 nehmen in Polen Übergriffe auf Juden
drastisch zu. Eine Weile hält sich die Frage, ob Hitler blufft. Rywka wundert
sich, was plötzlich mit den Leuten in Tarnów los sei. Rudek stellt fest: „Sie
sagen Dinge, die sie vor ein paar Jahren noch nicht einmal zu denken gewagt
hätten.“ Łoziński veröffentlichte den Roman im Original 2019, in
Polen regierte die rechtspopulistische PiS.
Juden machten in Tarnów immer etwa die Hälfte
der Bevölkerung aus. Im Februar 1945 hatten 232 überlebt.
Weniger als ein
Prozent der jüdischen Bevölkerung von 1942.
Mikołaj Łoziński, „Stramer. Ein Familienroman“. Aus dem
Polnischen von Renate Schmidgall. Suhrkamp Verlag, Berlin. 410 Seiten, 26,00
Euro.
