Postkoloniale Klassiker: Was sagt uns dies Sklavenschiff?
Im Jahr 1840 präsentierte die Royal Academy of Arts in London ein Gemälde von J.M.W. Turner, bei dem man genau hinsehen musste, um zu begreifen, was da eigentlich dargestellt wird. Wie zur Vorsicht trug das Bild einen ausführlichen erklärenden Titel: „Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying – Typon coming on“. Heute spricht man geläufiger einfach von „The Slave Ship“. Wer das Original sehen will, muss nach Boston fahren. Turner ist berühmt für seine luziden Studien von Licht- und Wetterverhältnissen, er malte oft den Himmel und entdeckte darin nicht selten einen Vorschein von Abstraktion.
„The Slave Ship“ zeigt ebenfalls ein Schauspiel der Elemente, aber zugleich, und beinahe von den Wellen verschlungen, ein historisches Ereignis von eminenter politischer Bedeutung. 1781 hatte der Kapitän der Zong, eines Sklavenschiffs mit Kurs auf Jamaika, 132 Menschen seiner Fracht über Bord werfen lassen, ein Ereignis, das von der Bewegung der Abolitionisten, die sich gegen den Handel mit versklavten Menschen engagierten, aufgegriffen und zu einem Moment ihrer Agitation gemacht wurde.

Der britische Sozialphilosoph Paul Gilroy erwähnt Turners Bild in seiner klassischen Studie „Schwarzer Atlantik. Moderne und doppeltes Bewusstsein“ eher beiläufig im Zusammenhang mit einem pointierten Zitat, dem zufolge „das Schiff das wichtigste Medium panafrikanischer Kommunikation bis zur Erfindung der Langspielplatte blieb“ (Peter Linebaugh). Gilroy hätte aber ebenso gut von Turner ausgehend die Facetten einer Moderne rekonstruieren können, deren „Urgeschichte . . . vom Blickwinkel der Versklavten aus“ er in „Schwarzer Atlantik“ zu schreiben versuchte. Die Originalausgabe erschien 1993, sie wurde auch in Deutschland intensiv gelesen, sodass man nun beinahe fragen könnte, ob es eine Übersetzung noch brauchte.
Der Zufall bringt es mit sich, dass in dieser Saison auch noch ein zweites Standardwerk der postkolonialen Theorie gleichsam nachgeholt wird. Der kleine Berliner Alexander Verlag bringt „Vergangenheit verschweigen. Macht und die Produktion von Geschichte“ des haitianischen Theoretikers Michel-Rolph Trouillot heraus, dessen Originalausgabe 1995, also zwei Jahre nach „The Black Atlantic“, veröffentlicht wurde. Es hatte nicht in Ansätzen die Wirkung, die Gilroy mit seinem Opus magnum erzielte. Immerhin aber wurde Trouillot zu einem Teil der Debatte, als er 2004 im Katalog zu der Ausstellung „Der Black Atlantic“ auftauchte, die das Berliner Haus der Kulturen der Welt mit Gilroy gemeinsam ausrichtete.
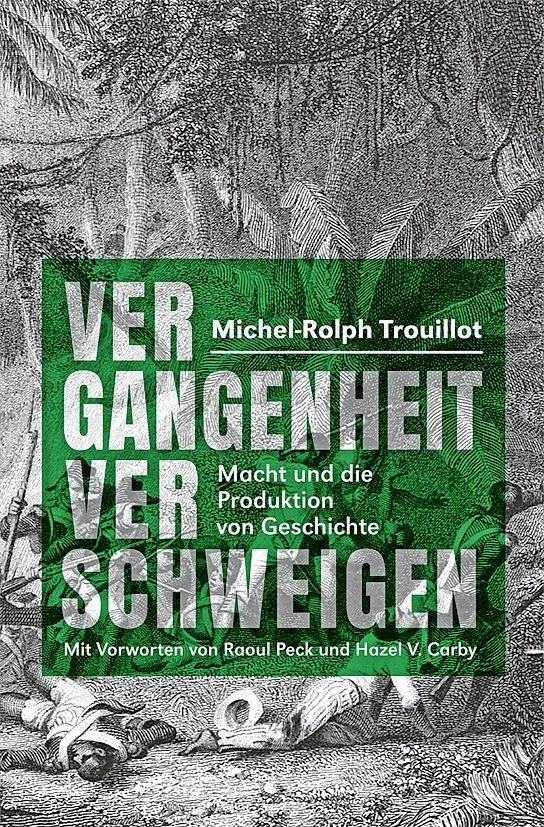
Trouillots Thesen zu einer „Bagatellisierung“ der haitianischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts werden seither zunehmend intensiver diskutiert. 2021 ließ sich der Filmemacher und kurzzeitig auch haitianische Kulturpolitiker Raoul Peck für seinen Fernsehmehrteiler „Rottet die Bestien aus!“ wesentlich von „Vergangenheit verschweigen“ inspirieren.
Was macht man nun mit zwei Büchern, die mehr als dreißig Jahre alt sind und damit aus einer Zeit stammen, als die postkoloniale Theorie in Europa noch tief in den Cultural Studies steckte und in der die Globalgeschichte mit ihrer Kritik der Eurozentrismen sich gerade erst zu entfalten begann?
Verspätete Übersetzungen haben oft ihre eigenen Kairologien, und so könnte sich hier erweisen, dass Gilroy, wiewohl intensiv zitiert, vielleicht mit entscheidenden Aspekten seines Werkes noch gar nicht auf der Ebene ernst genommen wurde, auf die er eigentlich zielt. Von Trouillot wiederum wird heute sicher kein Umsturz der geschichtswissenschaftlichen Epistemologien mehr ausgehen, aber seine Korrektur der Gewichtungen, wenn man von einem „Zeitalter der Revolutionen“ spricht, ist wegweisend, und sie führt ebenfalls zu dem Punkt, auf den es Gilroy in erster Linie ankommt – zu einer Überprüfung von Modernitätskonzeptionen.
Der Schmerz der Moderne
In „The Black Atlantic“ bildet die schwarze, populäre Musik, entstanden in einer Diaspora zwischen den Kontinenten, die durch den Sklavenhandel verbunden waren, ein Idiom, vom dem Gilroy herausfinden möchte, ob es etwas zu den Verständigungen beitragen kann, die bei Jürgen Habermas auf Sprache (also Alphabetisierung) und Vernunft beruhen. Die Passagen zu Spirituals, Reggae und Hip-Hop vor allem waren es, die Gilroy ein Publikum auch in Deutschland beschert haben, und seine Rezeption wurde bisweilen enggeführt auf die eines Poptheoretikers. Mit der deutschen Übersetzung, die bei manchen vielleicht erst jetzt eine gründliche Gesamtlektüre des Buchs mit sich bringen mag, wird nun deutlich, dass das unausdrückliche Gespräch, das „Der Schwarze Atlantik“ mit Habermas und dem „Philosophischen Diskurs der Moderne“ sucht, in vielerlei Hinsicht erst noch zu führen ist.
Denn es ist immer noch offen, wie diese Moderne mit Schmerz, mit Trauma und mit jenem „doppelten Bewusstsein“ umgeht, das Gilroy von W.E.B. DuBois übernimmt und das eine Subjektposition auszeichnet, die sich erst durch den rassistischen Ausschluss konstituiert – ein Bewusstsein, dass den ablehnenden Blick in sich aufnimmt. Schwarze Menschen können als Erben der Versklavung nicht einfach ohne Weiteres in den Diskurs eintreten. Denn davor ist zu klären, ob ihr Beitrag überhaupt zählt, „ob ein Begriff der modernen Rationalität, wie ihn etwa Habermas zugrunde legt, Raum für ein befreiendes, ästhetisches Moment lässt, das nachdrücklich anti- oder gar prädiskursiv ist“.
Den Zionismus mit dem Afrozentrismus zusammendenken
Für einen heutigen postkolonialen Mainstream, der in Israel/Palästina zuletzt wieder einen globalen Bezugspunkt gefunden hat und der unzweifelhaft in Teilen antisemitisch ist, müsste wiederum bei Gilroy interessant sein, wie er den Zionismus mit afrozentrischen Bewegungen im 19. Jahrhundert zusammendenkt. Er plädiert dafür, den Verbindungen zwischen schwarzen und jüdischen Menschen „nachzugehen“, und erinnert daran, dass der Schriftsteller Martin Delany darüber nachdachte, dass afroamerikanische Menschen, die unter Lynchattacken und Segregation litten, in Südamerika „zionistisch“ eine Heimstatt suchen könnten.
In der Bedeutung der haitianischen Revolution für alle Konzeptionen von Modernität liegt die wesentliche Gemeinsamkeit zwischen Gilroy und Trouillot. Was als Aufstand begann und mit einer Staatsgründung 1804 endete, bildet „den ultimativen Prüfstein für die universalistischen Ansprüche“ der Französischen und der Amerikanischen Revolution, heißt es in „Vergangenheit verschweigen“. Interessant ist, wie Trouillot die „Verschweigung“ der dritten „atlantischen“ Revolution deutet. Sie war nämlich noch in dem Moment, in dem sie sich ereignete, „undenkbar“ – der Rassismus hatte die Kolonialherren schlicht in eine Position versetzt, die den Unterdrückten keinen Willen unterstellte. Auch damit wäre die Revolution in Haiti die revolutionärste, nämlich pure Emergenz: „Ihre politische Stimme fand sie erst im Laufe ihres Stattfindens.“
Trouillot geht mit seiner Analyse der Machtaspekte in historischen Überlieferungen so weit, dass er im Inneren der historischen Ereignisse in Haiti eine „Verschweigung“ findet, die selbst der offiziellen, haitianischen Geschichtspolitik, die sich natürlich mit der Revolution zu schmücken versuchte, zu weit ging: Ein aus dem Kongo stammender Aufständischer namens Sans Souci ging in der Tradierung bewusst verloren. Historiographie ist für Trouillot in diesem Sinn Bergung verlorener Geschichtszeichen, und damit natürlich eminent auch Modernitätskritik.
An der Rezeptionsgeschichte von Turners Bild „The Slave Ship“ kann man sehen, wie sich die aus Gilroys und Trouillots Sicht defiziente Moderne behauptet. Das Gemälde wurde vorwiegend als große Kunst und als Ausdruck formaler Meisterschaft gesehen. Die Aspekte daran, die auch die Funktion eines Plakats, eines Manifests hatten, wurden nicht ausdrücklich verschwiegen, aber sie verschwanden ein wenig hinter der Kunstwirkung. Für eine Moderne, die sich auf ihr Grundprinzip, eine niemals versiegende Reflexivität, verlässt, sind die gegen den Strich lesenden Bücher von Gilroy und Trouillot auch nach dreißig Jahren weiterhin ein Geschenk.
Michel-Rolph Trouillot: „Vergangenheit verschweigen“. Macht und die Produktion von Geschichte. Aus dem Englischen von Michael Schiffmann. Mit Vorworten von Raoul Peck und Hazel V. Carby. Alexander Verlag, Berlin 2025. 296 S., Abb., geb., 38,– €.
Paul Gilroy: „Schwarzer Atlantik“. Moderne und doppeltes Bewusstsein. Aus dem Englischen von Utku Mogultay. Merve Verlag, Leipzig 2025. 432 S., geb., 28,– €.
Source: faz.net
