Erinnerungskultur: Die Geister, die uns rufen
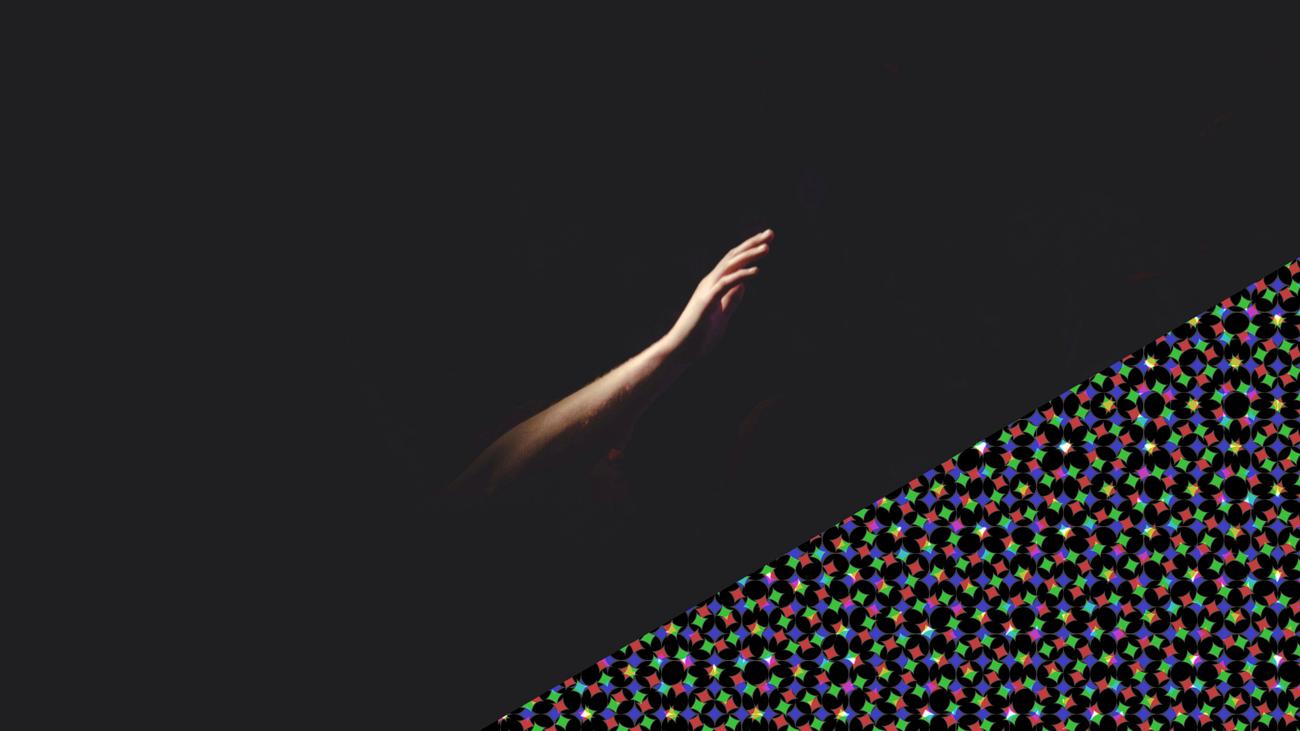
Als sich unsere Autorinnen das erste Mal begegnen, haben sie beide bereits einen Roman veröffentlicht, in dem Geister oder Gespenster eine nicht unwesentliche Rolle spielen. In beiden Texten geht es um Heimsuchung, aber auch um die Notwendigkeit zu erinnern und koloniale Gewalt. Aus der ersten Begegnung entsteht ein Dokument, in dem die Autorinnen assoziativ aufeinander antworten (hier durch den Wechsel von kursiver und nichtkursiver Schrift dargestellt) und sich das eigene Ich zunehmend auflöst. Was bleibt, ist die Frage: Was können wir von den Geistern der anderen lernen?
2012, mit Anfang zwanzig, besuche ich die ehemals
deutsche Kolonie Togo. Mit jedem Tag fühle ich mich weißer werden. Ich laufe durch die Straßen, Ruinen alter
Kolonialgebäude, eine von Deutschen angelegte Allee. Jemand erzählt, dass sich
das deutsche Wort „Schwein“ bis heute im Wortschatz vieler Togoles*innen hält.
Es ist das Schimpfwort, das deutsche Beamte bis 1914 für die einheimischen
Zwangsarbeiter*innen benutzten, während diese die Alleen pflanzten, die Gebäude
bauten und die Schienen verlegten, über die ich heute spaziere. Schauer jagen
mir den Rücken herunter. Dabei bin ich es doch selbst, das Gespenst.
In letzter Zeit sehe ich sie deutlicher. Die Geister,
die durch Deutschland ziehen, und diejenigen, die die Deutschen andernorts
hinterlassen haben. Sie graben sich ein in Erinnerungen, die ihnen nicht
gehören sollten. Das „haunting“ der Deutschen ist ein Nachlass des Grauens:
Holocaust und Völkermord, letzteres oft im deutschen Gedächtnis unsichtbar.
Höchstens etwas, das am Rande des Bewusstseins zu kratzen scheint.
In ihrem Essay Ghost sucht Mirene Arsanios das
Gespenst zu beschreiben. Es sei „needy“, etwas, das
herumnörgelt und gesehen werden möchte: „They demand that the invisible be
seen. They insist that the invisible
not be reduced to visibility. They find representation intolerable.“
Wie also
lässt sich hier über Gespenster schreiben, die sich doch allem entziehen; der
Zeit, dem Ort, unseren Sinnen?
Kürzlich bei einer Lesung erzählt
mir eine Lehramtsstudentin für Geschichte, dass deutsche Kolonialgeschichte zwar
neuerdings im Rahmenlehrplan stehe, aber kein Thema für die Abiturprüfungen
sei, was im Umkehrschluss bedeute, dass es zwar an offizieller Stelle auftauche,
de facto aber nicht relevant sei. In den allermeisten Fällen, sagt die
Studentin, falle das Thema einfach hinten über.
Ich denke: Wer kann sich das heutzutage
noch leisten?
Wir, nicht weiße Deutsche und nicht Deutsche mit
Deutschlandbezug, werden anders heimgesucht. Unsere Erinnerungen und Sehnsüchte
sind Geister. Wir rufen sie an und fürchten uns nicht davor, sie nicht mehr
loszuwerden. Denn sie stellen Verbindung dar, zu einer Geschichte, die es nicht
geben darf oder kann.
Als sich unsere Autorinnen das erste Mal begegnen, haben sie beide bereits einen Roman veröffentlicht, in dem Geister oder Gespenster eine nicht unwesentliche Rolle spielen. In beiden Texten geht es um Heimsuchung, aber auch um die Notwendigkeit zu erinnern und koloniale Gewalt. Aus der ersten Begegnung entsteht ein Dokument, in dem die Autorinnen assoziativ aufeinander antworten (hier durch den Wechsel von kursiver und nichtkursiver Schrift dargestellt) und sich das eigene Ich zunehmend auflöst. Was bleibt, ist die Frage: Was können wir von den Geistern der anderen lernen?
