Christoph Poschenrieder: Ein Autor macht Schluss
Seine Homepage zeigt das Bild einer Grabinschrift. In Großbuchstaben steht da „Der R st ist Sch eigen“, in der Mitte das griechische Monogramm für Christus, XP. Gestorben ist aber nicht, nur den Schriftsteller in sich hat er beerdigt, der Münchner Christoph Poschenrieder. „großbuchstaben sind leider aus, und vokale werdn immr knppr. w sll mn d nch bchr schrbn? [und wer sie lesen?]“, so steht es unter dem Epitaph. Galgenhumor? Was ist geschehen?
2010 veröffentlichte der damals 46 Jahre alte Poschenrieder bei Diogenes seinen ersten Roman „Die Welt ist im Kopf“. Im Zentrum der junge Arthur Schopenhauer, das Buch war ein Erfolg bei Kritik und im Buchhandel. Eine neue Stimme, ein poeta doctus, der süffig formulieren kann, ein vorzügliches Debüt. Seither hat Poschenrieder weitere sieben Romane vorgelegt, für die das Gleiche gilt. Und dennoch wurde Anfang des Monats bekannt, dass er bereits seit einem Jahr als Straßenbahnfahrer in München arbeitet, die Literatur an den Nagel gehängt hat. Am Rande einer Lesung in Köln hatte er der „Frankfurter Rundschau“ sein Herz ausgeschüttet.

Er sei mit Anfang sechzig als weißer alter Mann unattraktiv fürs Feuilleton, die Zeit der Stipendien sei längst vorbei, Autorenmarketing sei heute entscheidend und so weiter. Um es mit einem Satz des von Poschenrieder verehrten Gustav Meyrink zu sagen: „Man kann vom Dichten erst leben, wenn man längst krepiert ist“. Das Dichten bleibt also ein Lebensphase: Poschenrieder, 1964 im Großraum Boston geboren, besuchte die Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München sowie die Journalistenschule der Columbia University in New York, er arbeitete als freier Journalist und – wie seine Frau Daniela Agostini – als Dokumentarfilmer.
Ob er die Demission nicht doch noch einmal überdenkt?
Als Romancier war er jedenfalls rasend fleißig. In rascher Abfolge veröffentlichte er „Das Sandkorn“ (2014), „Der Spiegelkasten“ (2011), „Das Sandkorn“ (2014), „Mauersegler“ (2015), „Kind ohne Namen“ (2017), „Der unsichtbare Roman“ (2019), „Ein Leben lang“ (2022), „Fräulein Hedwig“ (2025). Und er wurde wahrgenommen, mit großen Besprechungen, allein in der F.A.Z. wurden fünf der acht Romane rezensiert. Ins Programm des Diogenes Verlags passen Poschenrieders Romane gut – literarisch ambitionierte Unterhaltungsliteratur im besten Sinn, keine avantgardistischen Ausflüge, klassische Erzählkunst. Diogenes ist dafür bekannt, sich mit Nibelungentreue für das Gesamtwerk seiner Autoren einzusetzen. Und trotzdem scheint es nicht genug gewesen zu sein.

Man wüsste gern, wodurch der Autor eventuell umzustimmen wäre? Ob er seine Demission noch einmal überdächte, wenn ihm ein geschäftstüchtiger Agent einen sechsstelligen Vorschuss und einen Vertrag über mehrere Romane nebst Marketing- und Werbungskonzept auf den Tisch legen würde? Oder eine Verlegerin ihn dazu bewegen könnte, den Verlag zu wechseln, weil dort alles für ihn tun werde? Antworten gibt es keine, nach anfänglicher Zusage hat Poschenrieder Autor das Gespräch mit der F.A.Z. wieder abgesagt.
Und der Diogenes-Sprecherin Henriette Kuch blieb nur ein Farewell: „Wir bedauern die Entscheidung sehr, zumal Christoph Poschenrieder ein wunderbarer Autor ist, der für eine hohe literarische Qualität steht, respektieren aber seine Entscheidung.“ Apropos Diogenes. Dort spült seit nunmehr vierzig Jahren ein Roman Geld in die Kasse, der sich dem Konzept des Autorenmarketings von Anfang radikal versagte – Patrick Süskinds „Das Parfüm“. Die reine Lehre, nur Text, kein Autor. Süskind blieb ein Phantom, gab keine Interviews, man kennt ihn nur von schemenhaften Bildern. Und es stimmt schon, der Literaturbetrieb hat sich seither mehrmals gehäutet. Die Autorin von heute soll gut aussehen, mehrere Identitäten und Berufswege in sich vereinigen, als Performerin in Funk, Film, Fernsehen und Sozialen Medien überzeugen.
Die letzte Veröffentlichung wird eine höchstpersönliche gewesen sein
Frau sein ist im Augenblick sicher hilfreich, aber es gibt auch Männer, die abgehen. Bei Diogenes fiele einem da Takis Würger ein, der allerdings zwanzig Jahre jünger ist als Poschenrieder. Würger hat die Herzen der Buchhändlerinnen und Leserinnen erobert. Sein aktueller Roman „Für Polina“ steht seit fünfzig Wochen auf der „Spiegel“-Bestsellerliste. Dem Vernehmen nach hat Würger, was Poschenrieder fehlt: Rampensau-Qualität. Die hilft sehr, denn Einkünfte aus Lesungen spielen für das Einkommen von Autoren noch immer einer Rolle. Auch Poschenrieder bestätigte das, als er der FR-Reporterin sagte, dreißig Lesungen pro Roman wäre aus finanzieller Hinsicht schon erstrebenswert. Ein ehemaliger Verlagskollege von ihm, der Schweizer Weltbürger Hugo Loetscher, kam auf hundert Lesungen pro Jahr.
Wenn Poschenrieder also bei seinem Entschluss bleibt, wird „Fräulein Hedwig“, Ende Oktober erschienen, seine letzte literarische Veröffentlichung bleiben. Die Geschichte der 1884 geborenen Hedwig Poschenrieder ist der fiktionale Versuch, Gerechtigkeit für die Großtante herzustellen, die von den Nationalsozialisten umgebracht wurde.
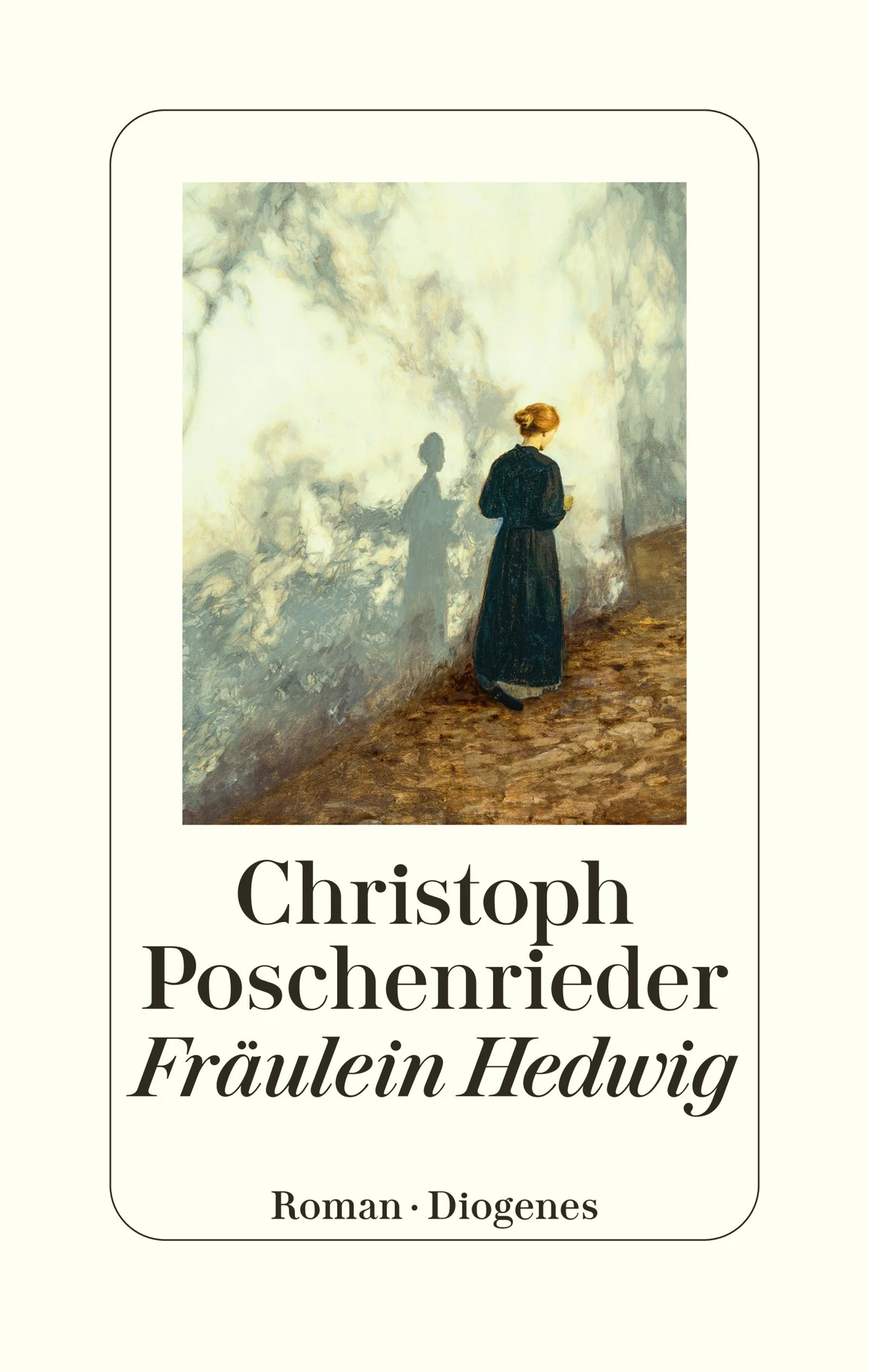
Ihren künstlerischen Neigungen nachzugehen, verbot man der Erstgeborenen eines bayerischen Lehrers, der im Alter von 44 Jahren starb, eine Frau und vier Kinder hinterließ. Die nach dem Tod ihres Mannes als Gymnasialprofessorswitwe firmierende Mutter Hedwigs überlebte ihren Mann um Jahrzehnte. Hedwigs Erziehung ist streng, der Regensburger Generalvikar Alphons Scheglmann, ein religiöser Eiferer, setzt ihrem Geisteszustand mit Versündigungsphantasien stark zu.
Hedwig ergreift den einzig möglichen Beruf, sie wird Lehrerin. Unterrichtet als Studienrätin, unterrichtet in München und Regensburg, schon mit Mitte zwanzig plagen sie „Gemütsdepressionen“, 1928 wird sie wegen „manisch depressiven Irreseins“ in die Psychiatrische und Nerven-Klinik in der Münchner Nußbaumstraße eingeliefert – es besteht akute Suizidgefahr. Man entlässt sie aus dem Schuldienst, fortan lebt sie im Haushalt ihrer Schwester Marie, die sich um sie kümmert.
Selbstvergewisserung eines Autors über seine Wurzeln
Als die Nazis an die Macht kommen, erlassen sie gleich im Juli 1933 das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, Hedwig fällt mit ihrem Krankheitsbildes in die Kategorie „erbkrank“, ist von Sterilisation bedroht, gilt als „lebensunwertes Leben“. Im Juni 1944 läuft sie desorientiert und verwahrlost sogar bei Fliegeralarm auf den Straßen Münchens herum, bis die Luftschutzpolizei sie aufgreift. Diesmal diagnostiziert man eine „paranoische Psychose“ und überstellt sie in die geschlossene Psychiatrie nach Eglfing-Haar. Drei Wochen später ist sie tot.
Für Poschenrieder ohne Zweifel ein Fall von Mord, seit er vor acht Jahren auf das bei Wallstein vorgelegte „Gedenkbuch für die Münchner Opfer der nationalsozialistischen ‚Euthanasie-Morde‘“ auf Hedwigs Namen stieß, ihre Krankenakte lieferte ihm weitere Aufschlüsse. Basis des Romans sind eine Fragment gebliebene Lebensgeschichte Maries, Familienfotos, Postkarten, Briefe, Archivfunde. Anderes, wie die letzte Ruhestätte, bleibt im Dunkeln, so ist Hedwig Poschenrieders Geschichte am Ende nur eine Teilerlösung vergönnt.
Der Roman ist auch eine Selbstvergewisserung des Autors über seine Wurzeln. Die liegen im Tal der Schwarzen Laber, westlich von Regensburg, wo bis heute eine Mühle in Familienbesitz ist, seit 1809. Poschenrieder steigt tief in die Alltags-, Kirchen- und Medizingeschichte ein, um seine Rekonstruktion mit Fakten anzureichern. Das führt zu mancher Länge, aber auch zu überraschenden Funden wie jenem, dass die Familie Poschenrieder in Alfred Anderschs „Der Vater eines Mörders“ auftaucht, sowie zur irrigen Annahme, Burghausen läge am Inn.

Die Familiengeschichte als Wille und Vorstellung: Viele Stimmen, viele Verschweiger und ein Nachgeborener, der mit großer Imaginationskraft sagt: So ist es wahrscheinlich gewesen. Auf seiner Homepage schreibt Christoph Poschenrieder „follow no one“. Berühmte letzte Worte? Seine Leser sind ihm jedenfalls gern gefolgt.
Source: faz.net
