Trump-Richterin Barrett: Erst dies Urteil, dann die Begründung?
Besucht man den US Supreme Court in Washington, D.C., bedingt üppig verbauter weißer Marmor ein eher kühles Erscheinungsbild. Doch im Inneren des Gerichts stößt man auf einen mit Holz ausgekleideten „gift shop“, der von der Supreme Court Historical Society betrieben wird. Zwischen Krawatten, Kaffeebechern und Justitia-Briefbeschwerern findet sich auch eine Auswahl an Büchern.
Gut in ihnen vertreten ist ein Genre, das sich in Deutschland – etwa mit Susanne Baers Buch „Rote Linien“ – erst in seinen Anfängen befindet: Autobiographien von Richtern. Sie sind meist weder rein persönlich gehalten noch darauf bedacht, Rechtfertigungen eigener Positionen ins Zentrum zu stellen. Oftmals bilden sie vielmehr einen Hybrid aus edukativem Ansatz und Betrachtungen der Justizinstitution, für die man arbeitet oder gearbeitet hat. Im missratenen Fall haben sie einen Hang, eigenen Auffassungen nachträglich noch einmal den letzten Segen zu erteilen.
Coney Barretts Weg vom katholischen Elternhaus zum Supreme Court
Die Autobiographie der 2020 bestätigten US-Supreme-Court-Richterin Amy Coney Barrett, „Listening to the Law“, stellt den jüngsten Beitrag zu diesem Genre dar. Mit privaten Einblicken verfährt Barrett dabei sehr zurückhaltend. Eher in einem knappen Abriss beleuchtet sie ausgewählte Stationen ihres Werdegangs, vom katholischen Elternhaus in New Orleans über die akademische Laufbahn und Familiengründung bis hin zur Ernennung als Supreme-Court-Richterin. So erfährt der Leser, dass Barrett ursprünglich mit dem Gedanken spielte, in den Literaturwissenschaften promoviert zu werden, und im Umfeld der republikanischen Richter Laurence H. Silberman und Antonin Scalia ihr Handwerk lernte.
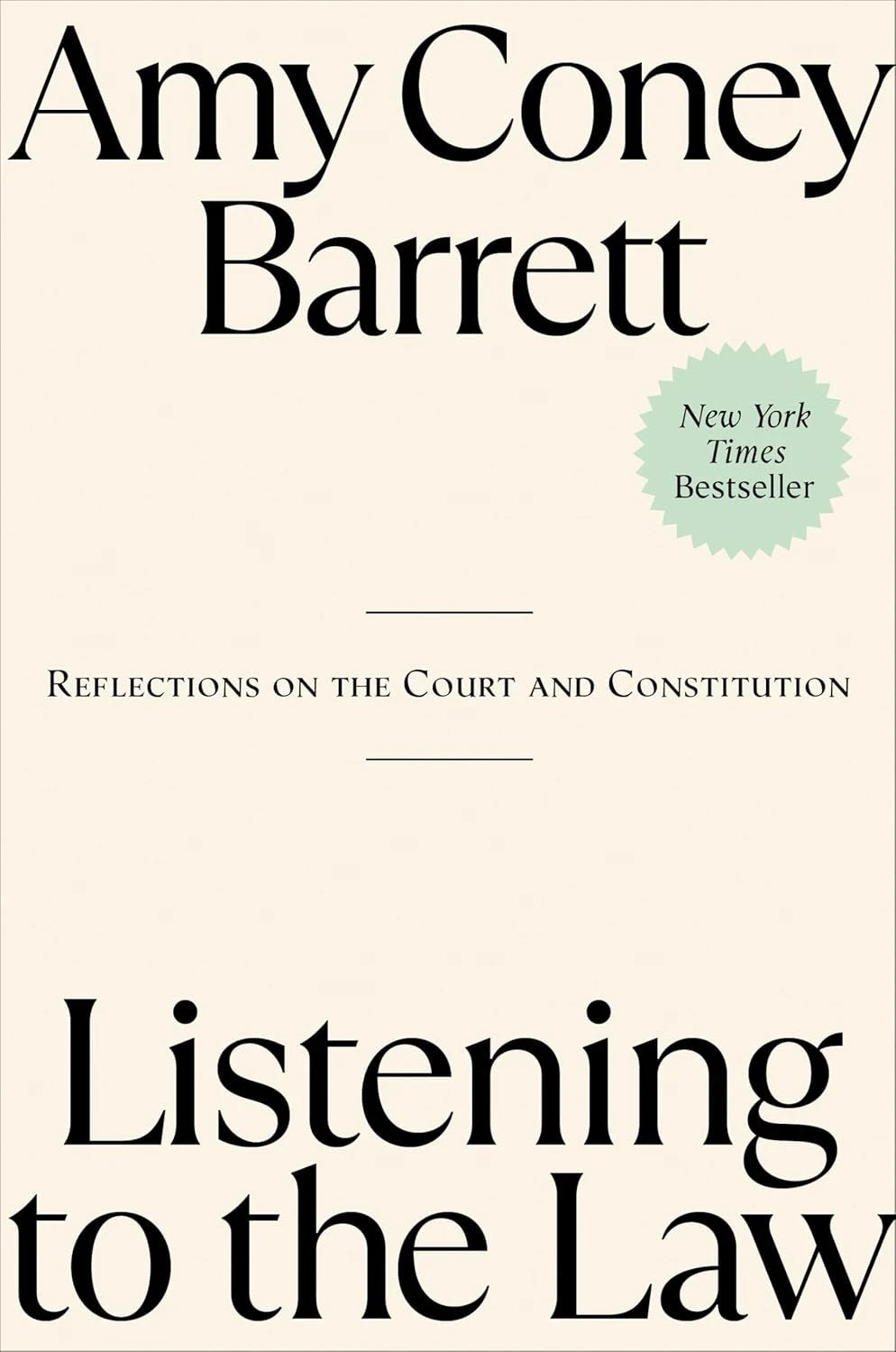
All dies war aber bekannt und ist frei von Überraschendem. Gänzlich spart Barrett ihre eigene Anwaltstätigkeit aus. Dass sie zwischen den Jahren 1999 und 2001 unter anderem Teil des Anwaltsteams im Verfahren Bush v. Gore war, das zugunsten von Bush vor dem Supreme Court erreichen konnte, die Fortführung der Neuauszählungen in Florida zu stoppen, bleibt so unerzählt.
Ins Zentrum ihrer Memoiren – für die sie kolportierten Berichten zufolge rund zwei Millionen US-Dollar erhalten haben soll – rückt die Verfassungsrichterin stattdessen das eigene Rechts- und Justizverständnis. Dazu untergliedert Barrett ihr Buch in drei große Themenkomplexe. Der weitestgehend sachlich gehaltene erste Teil („The Court and Its Work“) beschreibt die institutionelle Praxis des Supreme Court, die dortige Entscheidungsfindung, die Mittagessen unter den Richtern oder die wichtige Rolle der Clerks. Durchaus interessant ist, dass Barrett sich in diesem Zusammenhang auch um eine Rechtfertigung des sogenannten „shadow docket“ bemüht. Das als Eilverfahren konzipierte Instrument, mittels dessen der Supreme Court häufig ohne mündliche Verhandlung und teils ohne Begründung über zuvor von unteren Gerichten beanstandete Regierungsmaßnahmen entscheidet, beschreibt sie als funktionale Notwendigkeit richterlicher Arbeit.
Die Fragwürdigkeit der Eilverfahren
Nüchtern wird es folglich der verfahrensrechtlichen Alltagsbewältigung des Gerichts zugeordnet. Die mit dieser Praxis einhergehenden Probleme werden hingegen ausgeblendet. Dass entsprechende Eilbeschlüsse etwa Formen, durch die das Gericht für gewöhnlich seine Autorität herstellt – Öffentlichkeit, Zeitaufwand, Begründung –, unterschlagen, gilt es für Barrett schlicht zu akzeptieren. Oft stecke etwa hinter einer fehlenden Begründung schließlich nur, dass sich die Richter nicht hätten einig werden können. Die Begründung des Gerichts dann in gedruckter Form zu veröffentlichen, berge die Gefahr, dass etwas, das vorläufig sein sollte, zu etwas Definitivem erstarrt.
Mag dies etwa bei Zuständigkeitsfragen unter Umständen noch hinnehmbar erscheinen, ist es für materiell weitreichende Entscheidungen ohne anschließendes Hauptsacheverfahren vor dem Hintergrund der Rule of Law allerdings zu beanstanden. Eine Verfahrensart, die für Ausnahmesituationen angedacht ist, verkommt dadurch zu einem leicht zu missbrauchenden Hebel des Gerichts.
Auch deshalb darf nicht überraschen, dass gerade im Rahmen des „shadow docket“ die politischen Trennlinien innerhalb des Gerichts sichtbar werden. Für die zweite Trump-Administration (bis September 2025) wurde eine Erfolgsquote der Regierung auf dem „shadow docket“ von 84 Prozent erhoben, während die Biden-Administration gerade einmal 53 Prozent erreicht hatte. Diese Tendenz zeigt sich bisher auch bei Barrett persönlich und gerade in politisch wichtigen Verfahren.
Wie sind die Verfassungsartikel zu interpretieren?
Der zweite Teil von Barretts Buch („The Constitution and the American Experience“) rückt die Verfassung selbst in den Mittelpunkt, verstanden als historisch gewachsenes und politisch bis heute prägendes Dokument. Von Madison über Franklin bis hin zu den frühen verfassungspolitischen Kontroversen entfaltet Barrett eine kanonische Erzählung der amerikanischen Verfassungsgeschichte. Knapper fällt hingegen die Betrachtung der wenigen älteren wie jüngeren Verfassungsreformen – etwa infolge des Amerikanischen Bürgerkriegs (1861 bis 1865) – aus.

Der dritte Teil („Thinking About the Law“) schließlich bildet den normativen Kern des Buchs. Barrett legt hier insbesondere ihr methodisches Selbstverständnis als Richterin offen und verteidigt die von ihr vertretene originalistische Auslegung der Verfassung. Der Originalismus, der sich in der von Barrett vertretenen Spielart auf den zur Zeit der Verfassungsgebung öffentlich zugänglichen Bedeutungsgehalt (public meaning originalism) konzentriert, erscheint bei ihr dabei als Voraussetzung richterlicher Selbstbegrenzung. Um den Gehalt von Verfassungsbegriffen zu ermitteln, nutzt Barrett daher etwa als „starting point“ Wörterbücher aus der Entstehungszeit der Verfassung
Immer wieder beschreibt Barrett die richterliche Tätigkeit deshalb auch als einen Akt des Zuhörens. Für Barrett folgt ihre Befürwortung sowie die Vorrangstellung des Originalismus aus ihrem Rechtsverständnis („I’m an originalist because I think that it’s the right way to think about law.“). Dieses ist von der Überzeugung getragen, dass (Verfassungs-)Recht nicht im normativen Ermessen des Richters aufgeht, sondern als historisch fixierter, demokratisch gesetzter Maßstab vorgefunden und respektiert werden muss. Was in seiner Einfachheit überzeugend daherkommt, lässt jedoch eine argumentative Leerstelle entstehen. Verfassungsrichter sind schließlich nur scheinbar frei in der Wahl ihrer Auslegungsmethode.
Methodenfragen und Machtfragen
Hintergrund dessen ist, dass Methodenfragen, wie es im deutschen Rechtsraum insbesondere Bernd Rüthers fasste, nicht bloß Machtfragen sind, sondern letztlich selbst Verfassungsfragen. Eine Auslegungsmethode bedarf, abseits von allgemeingültigen Normen der Logik, daher ebenfalls einer Rückkopplung an die Verfassung. Diese herzustellen ist regelmäßig anspruchsvoll und endet nicht selten in verfassungstheoretischen Überlegungen, beschäftigen sich die meisten Verfassungen (so auch das Grundgesetz) doch nur randständig mit ihrer eigenen Auslegung.
Auch für die amerikanische Verfassung von 1787 ist daher seit Langem umstritten, ob und inwiefern sich Auslegungsmethoden aus ihrem Text ableiten lassen. Barretts „Ziehvater“ Scalia begründete den „public meaning originalism“ etwa einst damit, dass richterliche Normenkontrolle – soweit die Verfassung als „law“ im Sinne der Supremacy Clause (Art. VI) verstanden wird – nur dann legitim sei, wenn Gerichte einen rechtlich fixierbaren Bedeutungsgehalt anwenden und nicht eigene Werturteile an die Stelle des Verfassungstextes setzen.
Andere amerikanische Juristen wie etwa Stephen Breyer haben dem entgegengehalten, dass aus diesen Elementen gerade keine bestimmte Methode folgt, sondern die zahlreichen auslegungsbedürftigen normativen Begriffe der Verfassung vielmehr für eine innere Methodenoffenheit der US-Verfassung sprechen.
Deutschland steht ein vergleichbarer Methodenstreit noch bevor
Explizit aus der Verfassung abgeleitete Gründe, die für eine Anwendung des „public meaning originalism“, die Ablehnung des „original intent“ oder überhaupt für eine Hierarchisierung von Auslegungsmethoden sprechen, liefert Barrett jedoch nicht. Das ist bedauerlich, und sie kann auf diese Weise den Verdacht nicht substanziell entkräften, dass der Originalismus wie auch andere Auslegungsmethoden der Verfassung letztlich oft doch nur der Ex-post-Rationalisierung politisch gewünschter Ergebnisse (legal reverse engineering) dient und damit vor allem zeitbedingt ist.
Neuere lesenswerte Arbeiten – etwa Sebastian Schwabs Monographie „Geschichte und Argument“ (2024) – zeigen, dass Versuche einer Rückbindung von Methoden und Argumenten an die Verfassung hier durchaus Abhilfe hätten leisten können. Denn unabhängig davon, ob man entsprechenden Herleitungen aus der Verfassung letztlich folgt, besteht zumindest ein anschlussfähiger Begründungsrahmen.
Vielleicht soll der Leser von „Listening to the Law“ diesbezüglich aber auch selbst Antworten finden. Die 7591 Wörter lange Verfassung der Vereinigten Staaten liefert Barrett im Anhang jedenfalls mit. Diesseits des Atlantiks mag spätestens hier die Erkenntnis reifen, dass auch der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts ein vergleichbarer Methodendiskurs erst noch bevorsteht.
Amy Coney Barrett: „Listening to the Law“. Reflections on the Court and Constitution. Sentinel Books, New York 2025. 336 S., geb., 29,50 €.
Source: faz.net
