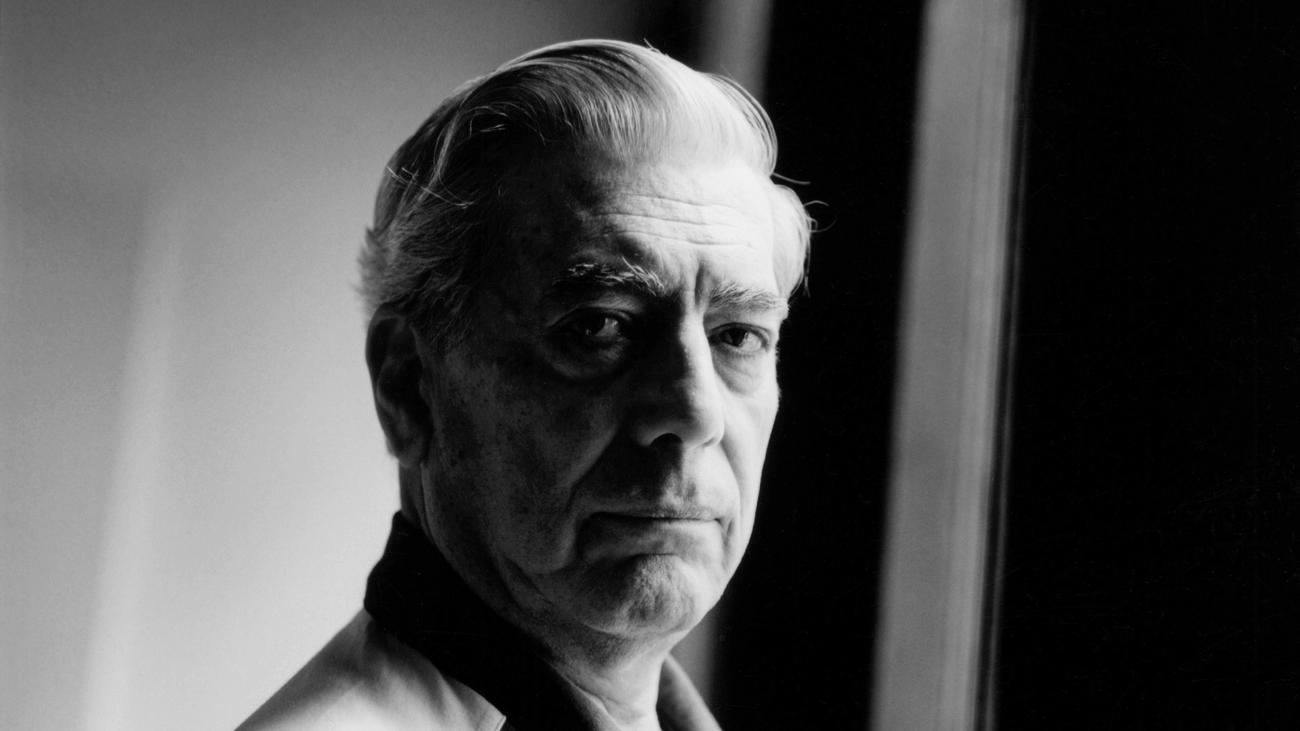
Mario Vargas Llosa lachte aus vollem Herzen, als wir ihn vor gut fünf Jahren in
Madrid besuchten und ihn nach seinem neuen Fünfjahresplan fragten. Das sei ja
ein guter Witz, meinte er. Schließlich sei er schon 83 Jahre alt. Und ja, es
stimme schon, er habe seine Arbeitspläne wie ein guter sozialistischer Staat
stets in Fünfjahresabschnitte eingeteilt. Nun könnte es damit aber langsam
knapp werden. Aber ja, einmal fünf weitere
Jahre plane er noch. Dann jedoch sei es wohl vorbei.
Das
war im November 2019. Mario Vargas Llosa wohnte – besser: residierte – damals
in einer prachtvollen Villa im Botschaftsviertel von Madrid. Er war ins Haus
seiner damaligen Lebensgefährtin Isabel Preysler eingezogen, Journalistin, Ex-Frau
von Julio Iglesias und anderen glanzvollen Männern. Ein Eingangsportal, das
lautlos aufschwebte, schwarze glänzende Limousinen vor der Tür, ein Butler mit
weißen Handschuhen, der uns einließ, ein prachtvolles Entree, große Ölgemälde,
auf einigen Isabel Preysler in rotem Kleid, links dann die große Bibliothek in
dunklem Holz, bis an die Decken voll mit Büchern, aus der kam Mario Vargas Llosa federnd zur Begrüßung herbei. Selten habe ich so einen vitalen, heiteren,
gelösten 83-jährigen Mann gesehen. Wir setzten uns auf die Terrasse, es war
noch warm in Madrid, ein parkartiger Garten, hohe Kastanienbäume warfen ihre
Früchte wie kleine Geschosse auf die Markise, unter der wir Platz genommen
hatten.
Mario Vargas Llosa, 1936 im peruanischen Arequipa geboren und im Jahr 2010 mit dem Nobelpreis
für Literatur ausgezeichnet, war einer der Grandseigneurs aus dem großen, alten
Reich der Literatur. Als er anfing zu schreiben, im Peru der Fünfzigerjahre, so
erzählte er es auf der Terrasse von Madrid, gab es so etwas wie Literatur in
Peru überhaupt nicht. Keine Verlage, wenig Leser, auf jeden Fall nichts, womit
man Geld verdienen könnte. „Ein Hobby für Zahnärzte und Anwälte“, sagte er
lachend. Aber er wollte es von früh an unbedingt. Schon allein, weil sein
strenger Vater, der seinen Sohn auf eine Militärschule schickte, diese Idee
absurd fand. „Es war einfach die sicherste Art, ihn komplett zu enttäuschen“,
sagte Mario Vargas Llosa lachend über seinen Vater.
Und
wie sehr hat er ihn enttäuscht. Als er dann auch noch, als 19-Jähriger, beschloss,
entgegen allen Konventionen seine 13 Jahre ältere Tante zu heiraten, war er
von seinen bürgerlichen Wurzeln endgültig befreit. Er widmete sein Leben der
Literatur. Und wurde einer jener Autoren – neben Isabel Allende und Gabriel García Márquez –, die die Glanzzeit des Magischen Realismus Lateinamerikas
prägten und ihm zu Weltruhm verhalfen. Literatur – aus der Wirklichkeit geboren –
mit Elementen des Fantastischen erweitert und belebt, die daraufhin zu einer,
ja, fantastischen Veränderung der Wirklichkeit beitragen kann.
So
beschrieb Mario Vargas Llosa es unter den herabsausenden Kastanien von Madrid:
Er habe so ein bisschen die ganze Weltreise der Literatur mitgemacht, von der
völligen Bedeutungslosigkeit zur Weltgeltung mit revolutionärem Potenzial und
globalem Publikumserfolg zurück zur relativen Bedeutungslosigkeit. „Heute“,
sagte er, „geht es in der Literatur oft nur noch um Unterhaltung, Wiederholung
von Altbekanntem.“ Das kritische Potenzial drohe verloren zu gehen. Aber: „Ich
glaube nicht, dass irgendetwas auf der Welt Literatur ersetzen kann. Literatur
erinnert uns daran, dass die Realität niemals genügt, um uns zufrieden zu
machen. Und dass wir eine andere, eine bessere Welt brauchen. Ich glaube, das
ist der große Beitrag der Literatur zum Fortschritt.“
Der Schriftsteller als Volkstribun, gar Präsidentschaftskandidat
Mario Vargas Llosa hat, wie so viele lateinamerikanische Autoren, als Linker begonnen
und sich mit den Jahren zu einem Liberalen, vor allem Wirtschaftsliberalen,
gewandelt. Er setzte sich Ende der Achtzigerjahre an die Spitze der Proteste
gegen die Privatisierung der Banken in Peru, schrieb ein Manifest, das dann in
kürzester Zeit zu einer Parteischrift wurde. Er wurde Anführer der
liberalen Movimiento Libertad, die sich mit den zwei großen peruanischen konservativen
Parteien zur Demokratischen Front (Fredemo) zusammenschloss. Und
1990 war er plötzlich Präsidentschaftskandidat, sprach vor 100.000 Menschen,
war eine Art Volkstribun geworden, die Wahl konnte er nach allen Prognosen gar
nicht verlieren. Und – verlor. Gegen den Außenseiter Alberto Fujimori. „Was für
ein Glück“, sagte Mario Vargas Llosa im Gespräch. Augenblicklich ließ er die
aktive Politik wieder sein – und schrieb wieder Romane, Erzählungen,
Kriminalromane, erotische Literatur, Essays. Über die Zeit seines politischen
Auf- und Abstiegs schrieb er den fantastischen autobiografischen Roman Der
Fisch im Wasser.
Mario Vargas Llosa war einer der letzten Autoren aus jener alten Zeit, die noch den
Anspruch an sich und ihre Bücher stellten, den „totalen Roman“ zu schreiben.
Die Gesellschaft in ihrer Komplexität abzubilden, Zeitromane zu schreiben, in
denen sich die wesentlichen gesellschaftlichen, politischen Strömungen abbilden
und die Unterströmungen der verschwiegenen Taten und Untaten der vorherigen
Generationen. Was für ein brillanter Roman ist Gespräch in der „Kathedrale“,
in dem die Geschichte Perus unter der Diktatur Manuel A. Odrías in den Fünfzigerjahren
in wohl 70 Einzelschicksalen erzählt wird. Erzählt, erzählerisch miterlebt und
zu einem großen Panorama verknüpft.
Oder die geniale knappe Novelle Die jungen Hunde über die Unmöglichkeit, „ein ganzer Mann“ zu werden. Oder Der
Geschichtenerzähler über die bedrohte Welt der Indigenen im Amazonasgebiet. Darin
heißt es: „Die Vorstellung des
Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur, das Bewusstsein der Umweltzerstörung
durch die Industriegesellschaft und die moderne Technologie, die Aufwertung des
Wissens des Primitiven, der gezwungen ist, seinen Lebensraum zu respektieren,
wenn er nicht untergehen will, ist eine Anschauung, die in jenen Jahren zwar
noch keine intellektuelle Mode darstellte, aber doch schon allenthalben, selbst
in Peru, Wurzeln zu schlagen begann.“
Oder
der Diktatorenroman Das Fest des Ziegenbocks,
in dem er Herrschaft und Niedergang Trujillos beschreibt, des Alleinherrschers
der Dominikanischen Republik. Mario Vargas Llosa verknüpfte in seinem Schreiben
traumwandlerisch die Traditionen des europäischen Romans mit der
lateinamerikanisch-magischen Erzählgegenwart. „Beim Schreiben des Ziegenbocks
habe ich immer wieder Joseph Roths Radetzkymarsch gelesen“, erzählte er im
Gespräch.

